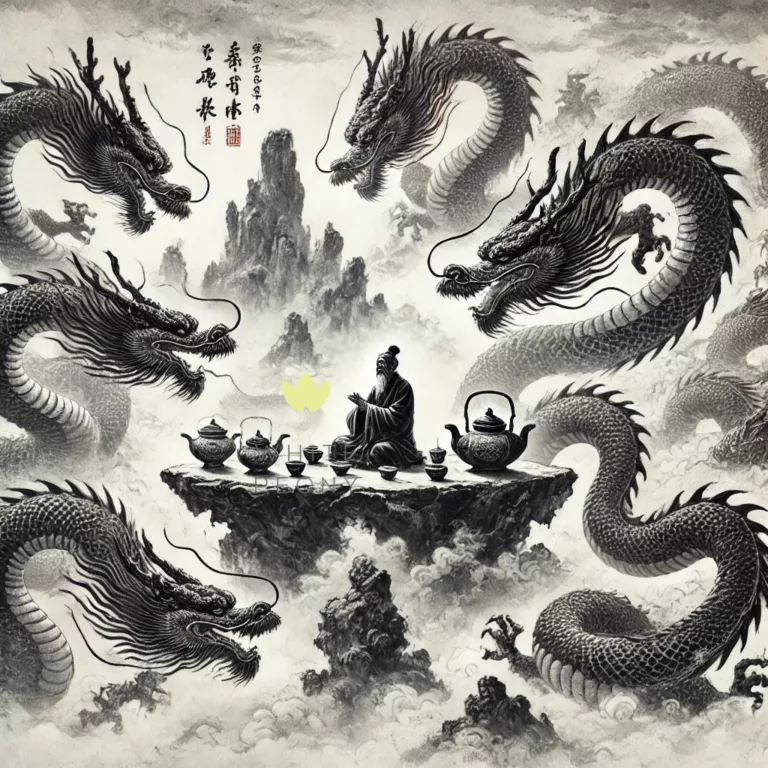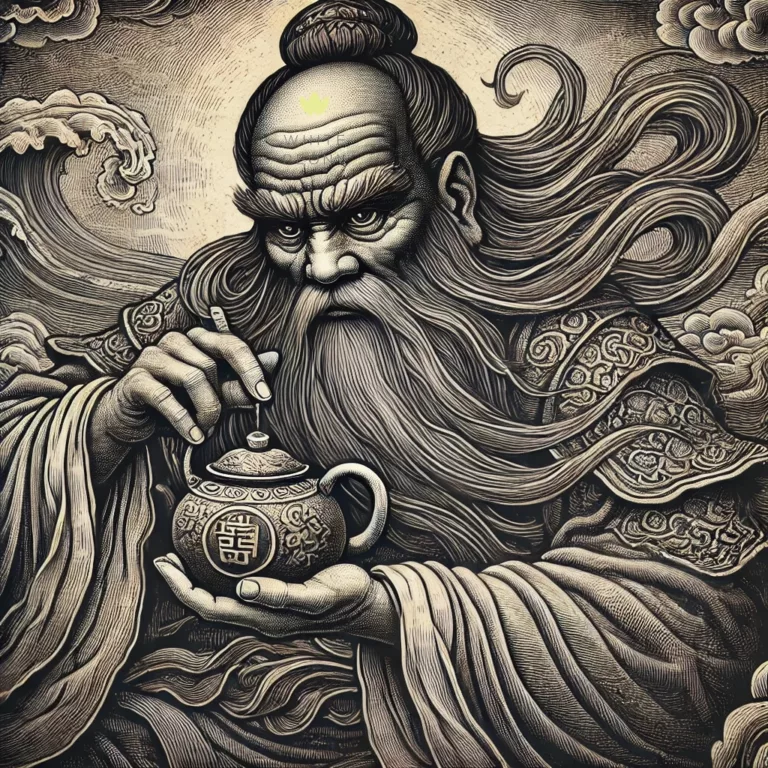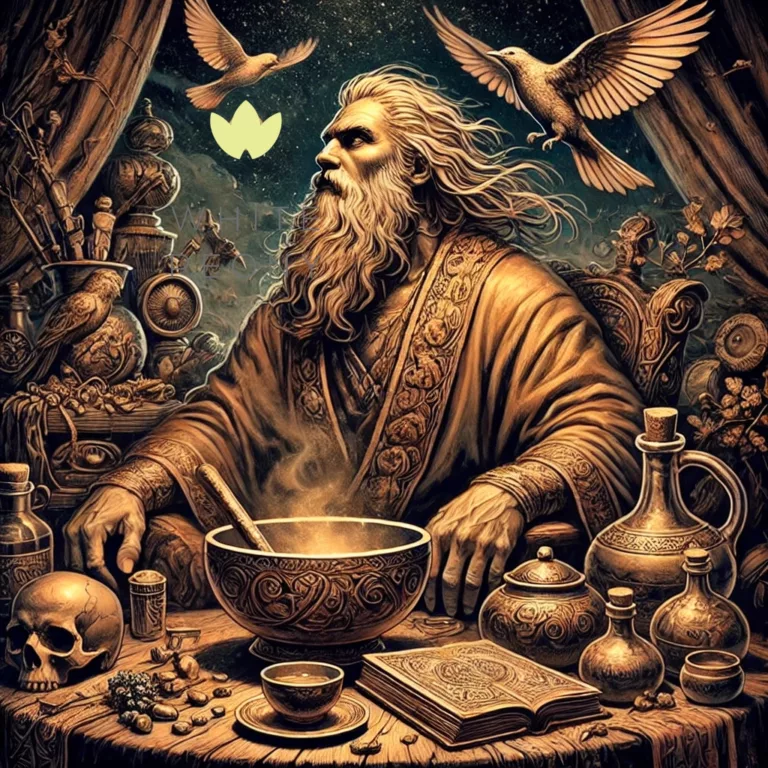An der Teezeremonie nehmen ein Gastgeber – ein Teemeister –, ein oder mehrere Gäste teil und es gibt einen besonders gestalteten Raum. Im Teezimmer gibt es nichts Überflüssiges: einen niedrigen Eingang, gegenüber ein Tokonoma, einen mit Tatami-Matten bedeckten Boden, ein kleines Fenster, das für gedämpftes Licht sorgt, einen Kamin. Bevor die Gäste eintreffen, schafft der Teemeister mit heiligen Gegenständen, Weihrauch und Blumen einen heiligen Raum. All dies wird nur für die Dauer der Teezeremonie im Raum platziert und anschließend aufgeräumt. Jedes Ereignis ist einzigartig, einmalig durch die Kombination der Bewegungen, Gegenstände, Gerüche. Wir werden feststellen, dass die während der Übung geschaffene heilige Umgebung eine gewisse Atmosphäre hat, deren Intensität jedoch variieren kann. Jedes Element der Teezeremonie trägt dazu bei, den Geist zu reinigen. „Der Anblick der Schriftrolle im Tokonoma und der Blume in der Vase reinigt den Geruchssinn; Wenn Sie dem Wasser lauschen, das im Eisenkessel kocht und aus dem Bambusrohr fließt, wird Ihr Gehör gereinigt. Wenn Sie das Teegeschirr berühren, wird der Tastsinn verfeinert; Wenn alle Sinne gereinigt sind, wird auch der Geist selbst von Verdunkelungen gereinigt.“
Wenn der Gast zum Beginn der Zeremonie den Teeraum betritt, befindet er sich in einem Raum, der bereits eingestimmt ist und ihn auf den folgenden Akt vorbereitet. Das Erste, was der Gast im Zimmer sieht, ist das Tokonoma (eine besondere Nische) und die Schriftrolle oder Blume in der Vase. Das Tokonoma enthält Objekte, die als Ergebnis heiliger Zen-Praktiken entstanden sind. Der geweihte Gast kann in ihnen die Grundgedanken der Lehren und spirituellen Erfahrungen des Autors „lesen“ und so die Erfahrung des Heiligen in sich selbst verwirklichen.
Während die Gäste ihre Plätze auf den Tatami einnehmen, erscheint der Besitzer im Teezimmer. Vor jedem Teilnehmer der Veranstaltung liegt ein gefalteter Fächer, der das Persönliche, das Individuelle symbolisiert. Nach der Begrüßung wird der Fächer unbedingt geputzt und dabei alles Weltliche, Eitle in den Hintergrund gedrängt. Dieser Moment symbolisiert die endgültige Trennung vom Profanen und die Bereitschaft, sich dem Heiligen anzuschließen. Im nächsten Schritt erfolgt die rituelle Bereitstellung der benötigten Utensilien. Der Teemeister legt den Tee zunächst in strenger Reihenfolge aus und reinigt dann jedes Objekt auf eine bestimmte Art und Weise. Der Zweck dieser Manipulationen ist nicht wörtlich, sondern symbolisch die Reinigung: In Übereinstimmung mit dem Bewegungsrhythmus wird ein bestimmter Atemrhythmus hergestellt, die Genauigkeit der zum Automatismus gebrachten rituellen Bewegungen ermöglicht es Ihnen, sich nicht von der Abfolge der Aktionen ablenken zu lassen und sich zu konzentrieren.
Die in ein Ritual verwandelte Zubereitung von Teegeschirr ermöglicht es, eine Situation zu schaffen, in der der Meister einen Kontrast zum Profanen bildet und bewusst eine Atmosphäre für die Manifestation des Heiligen schafft. Indem es zum Zentrum der Sakralisierung wird, verändert es nicht nur seinen inneren Zustand, sondern schafft auch eine heilige Umgebung um sich herum. Mit anderen Worten: Der vor Beginn der Veranstaltung vorbereitete heilige Raum wird während der Veranstaltung selbst allmählich zu einer heiligen Umgebung. Die Intensität des heiligen Mediums nimmt allmählich zu. Der Moment höchster Inspiration entspricht der Zubereitung des Tees und insbesondere dem Aufschlagen des Teepulvers mit einer kleinen Menge Wasser (in drei Schlucken) mit einem Tyason (Bambusbesen). In dieser Phase der Praxis wird der Körper des Meisters nicht durch den Verstand, sondern durch Intuition und Erfahrung gesteuert, das heißt durch das Verhältnis von Teepulver und Wasser, die Geschwindigkeit des Aufschlagens und, davon abhängig, durch den Geschmack des Tees. Anhand dieses Verhältnisses kann man den Zustand desjenigen beurteilen, der ihn zubereitet hat, und seine Fähigkeit, als „Dirigent“ des Heiligen zu fungieren.
Für die Praxis, die auf der Erstellung einer malerischen Schriftrolle basiert, ist kein besonderer Raum erforderlich. Sie kann jedoch in einem Raum durchgeführt werden, in dem sich Tokonomi mit frommen heiligen Gegenständen befinden, die als Quelle der Inspiration und der Erfahrung des Heiligen dienen können. Die Herstellung einer Schriftrolle beginnt wie die Teezeremonie mit der rituellen Vorbereitung der Materialien: Alle benötigten Gegenstände werden hervorgeholt und in einer besonderen Reihenfolge ausgelegt, Pinsel, ein Blatt Papier oder ein Stück Seide werden sorgfältig ausgewählt. Der Meister hält das Papier vor sich, fixiert es mit einer speziellen Presse, streicht es mit etwas Wasser auf einen Tuschstein usw.
Dabei sind zwei Varianten möglich: mit und ohne Zuschauer. In beiden Fällen verhält sich der Künstler gleich. In beiden Fällen geht der Künstler auf die gleiche Weise vor: Er bereitet Materialien für den Malprozess und sein eigenes Bewusstsein für die Erfahrung des Heiligen vor. Während er Materialien zum Malen vorbereitet, gerät er in einen meditativen Zustand, wechselt zum räumlich-figurativen Denken. Beim Betrachten eines leeren Blattes erlebt er kreative Inspiration, die dem Zustand der Erkenntnis nahe kommt. Das spontan im Kopf entstandene meditative Bild wird durch schnelle und präzise Pinselbewegungen fixiert. Das Heilige manifestiert sich und erhält einen sichtbaren Körper und eine sichtbare Form. Das resultierende Bild ist eine Art Aufzeichnung des Zustands des Meisters zum Zeitpunkt der Inspiration und Erleuchtung, sodass der Künstler das Bild nicht mit dem Modell vergleichen und zahlreiche Anpassungen vornehmen muss. Darüber hinaus erfordern sowohl Seiden- als auch Reispapier eine hohe Schreibgeschwindigkeit vom Künstler und bieten keine Möglichkeit, Korrekturen vorzunehmen, das Bild zu löschen oder zu überlagern.
Sowohl der Gast bei der Teezeremonie als auch derjenige, der über die Erstellung einer malerischen Schriftrolle nachdenkt, beobachten das Geschehen gleichermaßen, sind jedoch keine passiven Beobachter, sondern Teilnehmer des Geschehens. Bei der Durchführung der vermeintlich rituellen Handlungen leisten die Gäste ebenso wie der Meister aktive innere Arbeit und erfahren das Heilige. Durch konzentrierte Kontemplation und Einfühlungsvermögen bezieht der Meister den Betrachter zunächst ein und führt ihn dann. Bei der Durchführung der Übungen gibt er selbst seine Erfahrungen weiter und geht mit gutem Beispiel voran. Der Beobachter erhält eine spirituelle Erfahrung und verwirklicht das Zen-Postulat der Weitergabe der Wahrheit „von Herz zu Herz“, direkt vom Lehrer zum Schüler, ohne den Einsatz verbaler Mittel oder konzeptueller Konstruktionen und zeigt so „Aufrichtigkeit des Herzens“.
Das Eintauchen in die heilige Umgebung hilft, die Einheit mit den anderen Teilnehmern des Rituals zu spüren und schafft die nötige Stimmung, um in einen meditativen Zustand zu gelangen, in dem man „sich selbst vergisst, man selbst wird und eins mit den anderen wird.“ Je weniger Sie an sich selbst denken, desto näher kommen Sie anderen. In einem einheitlichen Rhythmus schlägt das „einzelne Herz“ gleichmäßig. Dies ist das Treffen von allem mit allem, das absolute Treffen der Herzen. Es gibt weder Raum noch Zeit, weder soziale noch nationale Unterschiede, weder das Eigene noch das des anderen, das Universum wird zum Wohnort von allem.
Die Art der Handlung, die Atmosphäre, in der sie stattfindet, und der Grad der Heiligkeit des Geschehens hängen daher nicht nur vom Gastgeber, sondern auch von allen an der Handlung Beteiligten ab. Der Gast im Teeraum muss die Elemente des Rituals beherrschen, um seine Tätigkeit ausführen zu können, ohne die Einheit und Integrität der Handlung zu zerstören. Der innere Zustand, der sich in der Körperhaltung, dem Atemrhythmus und in der Folge den Bewegungen widerspiegelt, kann den Manifestationsgrad des Heiligen unterstützen und sogar steigern. Die Anwesenheit eines erleuchteten Meisters als Gast kann bereits im Anfangsstadium des Aktes eine Sakralisierung vermitteln, da dieser über die Erfahrung, die „Gewohnheit“ verfügt, ohne besondere Anstrengung Hierophanie hervorzurufen: Sein Körper nimmt willkürlich die gewünschte Position ein, seine Atmung nimmt einen bestimmten Rhythmus an und sein Bewusstsein ist leer. Ist der Gast empört und durch Unkenntnis des Rituals eingeschränkt, entzieht sich ihm das Heilige und die Handlung verliert ihre Qualität spiritueller Kraft.
Beim Teeakt steht, anders als beim Erstellen einer Schriftrolle, zunächst der Gast im Mittelpunkt, ohne den der Akt nicht möglich ist. Der Gast wird in das gegenwärtige Geschehen nicht nur als kontemplativer Teilnehmer einbezogen, sondern hat auch eine gewisse Rolle im Ritual, er muss mit den Speisen umgehen und die heilige Atmosphäre aufrechterhalten. Die Gerichte sind dabei gleich vollwertige Teilnehmer. Die Teilnehmer der Aktion kommunizieren: Der Gast begrüßt das Gefäß mit einer Verbeugung und dreht es sofort „vorne“ zu sich, also auf die Seite, die durch das Bild oder die Textur hervorgehoben wird.
Jeder Gegenstand spielt seine eigene, ihm streng zugewiesene Rolle und bedarf einer besonderen respektvollen Behandlung und Verehrung, da er mit heiligen Eigenschaften ausgestattet ist. Der Kern der Zeremonie liegt allerdings nicht im Kult der Gegenstände oder des Tees selbst. Alle Veranstaltungen zielen darauf ab, eine Atmosphäre zu schaffen und aufrechtzuerhalten, die der Manifestation des Heiligen förderlich ist: „… Gäste, Besitzer, Teegeschirr – ein einziger Organismus, der einem einzigen Rhythmus unterliegt.“
Tea Vasiliy
Tea Alchymistr, Prag
Reisen Sie durch die Teetraditionen der Welt – abonnieren Sie und erkunden Sie globale Aromen.